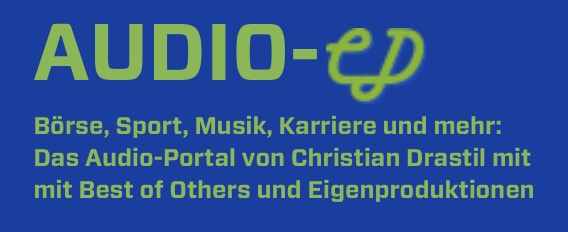E-Control: Aufwärtstrend am Energiemarkt
27.03.2025, 17311 Zeichen
Wien (OTS) - Das Jahr 2024 hat den Wettbewerb auf den Energiemärkten
zumindest in
Teilen zurückgebracht. Günstigere Preise auch für
Haushaltskund:innen, eine größere Auswahl an Angeboten zum
Vergleichen sowie ein wieder hohes Einsparpotenzial beim
Lieferantenwechsel prägten die Wettbewerbssituation. „Das bedeutet
aber nicht, dass wir mit den Gegebenheiten am Strom- und Gasmarkt
zufrieden sein können. Der Wettbewerb hat sich zwar im Vergleich zu
den Krisenjahren weiter verbessert, ist aber noch lange nicht auf
Vorkrisenniveau.“, zieht der Vorstand der E-Control, Wolfgang
Urbantschitsch, Bilanz über das Jahr 2024.
Zwtl.: Strom und Gas bleiben im Fokus
Die aktuellen Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage [1]
zeigen, dass sich die heimische Bevölkerung nach wie vor intensiv mit
dem Thema Strom und Gas beschäftigt. „Ein Trend, der seit dem Jahr
2023 ungebrochen groß ist. So geben 76 Prozent der Befragten an, sich
mit dem Thema Energiekosten grundsätzlich auseinanderzusetzen.“,
zitiert Urbantschitsch aus der aktuell verfügbaren Umfrage.
Zwtl.: Bei Wechselzahlen noch Luft nach oben
Im vergangenen Jahr ist zwar das Einsparpotenzial bei einem
Wechsel des Strom- oder Gaslieferanten wieder deutlich gestiegen, die
Wechselraten sind aber nicht über das Niveau von 2023 hinausgekommen.
„Bei der von uns in Auftrag gegebenen Umfrage hat mehr als die Hälfte
der Befragten angegeben, noch nie ihren Strom- oder Gaslieferanten
gewechselt zu haben, nämlich 52 Prozent bei Strom und 54 Prozent bei
Gas. Der Anteil jener Personen, die bereits mehrmals gewechselt
haben, liegt bei über 20 Prozent.“, so Urbantschitsch. Der Hauptgrund
für einen Lieferantenwechsel ist dabei nach wie vor die Ersparnis,
die sich derzeit (Stand 1. März 2025) gerade besonders lohnt. So
liegt diese bei einem Wechsel des Stromlieferanten inklusive
Neukundenrabatt im ersten Jahr im günstigsten Fall bei 450 Euro und
bei Gas – ebenfalls inklusive Neukundenrabatt im ersten Jahr – sogar
bei über 1.000 Euro.
Eine Basis für Konsument:innen, um überhaupt einen seriösen
Preisvergleich durchführen zu können, ist das Wissen über den
derzeitigen Strom- bzw. Gaspreis. „Nur wenn ich weiß, wieviel ich für
die Kilowattstunde Strom oder Gas bezahle, kann ich auch beurteilen,
ob sich ein Lieferantenwechsel für mich auszahlen kann. Und das
Wissen darüber nimmt leider nicht zu, eher im Gegenteil.“, bedauert
Urbantschitsch.
Zwtl.: Die Preissituation am Energiemarkt
2024 war am Großhandel im Wesentlichen ein konstantes Preisniveau
zu beobachten. Über das gesamte letzte Jahr hinweg lagen die Kosten
für die Lieferung von Strom (Base) bei etwa 10 Cent pro kWh und für
Gas zwischen 4 und 5 Cent pro kWh. „Der Großhandelsmarkt hat sich
somit weit unter dem Preisniveau der Krise stabilisiert, ist jedoch
nicht wieder am Vorkrisenniveau angekommen.“, analysiert
Urbantschitsch. Und zu den Preisen für die Endkund:innen erläutert
er: „Das spiegelt sich durchaus auch in den Endkundenpreisen wider:
Das günstigste Produkt erhält man derzeit sowohl bei Strom als auch
bei Gas im Durchschnitt zu Preisen, welche den Beschaffungskosten am
Großhandelsmarkt und einer relativ geringen angesetzten Marge
entsprechen. Für Strom zahlt man dementsprechend aktuell im besten
Fall etwa 10 Cent pro kWh, für Gas rund 5 Cent pro kWh.“
Zwtl.: Endkundenpreise bewegen sich langsam, aber sie bewegen sich
Die Preise für Hauptprodukte [2] , die also für einen großen Teil
der Bestandskund:innen gelten, sanken im letzten Jahr nur langsam,
gleichen sich allerdings allmählich an das Marktniveau an. „Die
Gründe für diese schleppende Entwicklung liegen zum einen an der
langfristigen Beschaffung der Incumbents, die zum Teil noch während
der Krise zu hohen Preisen erfolgte, zum anderen aber auch – wie die
Taskforce der Bundeswettbewerbsbehörde und der E-Control 2024
untersuchte – an der Preissetzungsmacht der Lieferanten in einem
Markt mit niedrigen Wechselraten.“, erläutert Urbantschitsch. Der
gewichtete Durchschnitt (nach Anzahl der beziehenden Kund:innen) lag
im Strom bei etwa 16 Cent pro kWh und im Gas bei knapp 7 Cent pro
kWh. Hervorzuheben ist, dass die Spannbreite der Hauptproduktpreise –
das heißt der Unterschied zwischen günstigstem und teuerstem
Hauptprodukt – seit einigen Monaten wieder auseinander geht, nachdem
die Differenz seit 2023 schrittweise abgenommen hatte. Die
Futurepreise für Strom und Gas bewegen sich derzeit weiterhin auf
konstantem Preisniveau. „Für die unmittelbare Zukunft gehen wir daher
nicht von anhaltenden großen Preisschwankungen aus.“, so
Urbantschitsch.
Zwtl.: Mehr Informationen ab sofort im neuen Preisportal der E-
Control
Nähere Details zu Preis- und Kostenentwicklungen wird es künftig
regelmäßig auf einem neu eingerichteten Preisportal der E-Control
geben, das ab sofort auf der Homepage der E-Control abrufbar ist:
https://www.e-control.at/preisportal-infos-rund-um-stro...
Hier werden unter anderem kurzfristige und langfristige
Beschaffungskosten der Lieferanten simuliert und der Preisentwicklung
auf dem Endkundenmarkt quartalsweise gegenübergestellt. „Auch wenn
untergeordnete Kosten der Versorgung und Margen der Lieferanten in
den Beschaffungskosten nicht betrachtet werden, so ist ein Vergleich
mit den Preisen für Endkund:innen dennoch sinnvoll: Wie zuletzt auch
gerichtlich bestätigt, müssen Preisänderungen in engem Zusammenhang
mit dem Wechsel der Beschaffungsbedingungen stehen. Je nach
Preismodell sollten sich also die Endkundenpreise ähnlich einer
kurzfristigen oder langfristigen Beschaffungsstrategie verhalten.
Starke Abweichungen der Tarife von einer bestimmten
Beschaffungskostenkurve, insbesondere über einen längeren Zeitraum,
deuten darauf hin, dass die Preise nicht konsequent einer
Beschaffungsstrategie folgen und der Lieferant einen möglicherweise (
zu) hohen Tarif verlangt.“, erläutert Urbantschitsch das neue
Preisportal.
Das Preisportal enthält außerdem einen (langfristigen) Produkt-
und Kostenvergleich. Spotprodukte gewinnen zunehmend an Bedeutung für
Stromkund:innen, da diese durch eine gezielte Verbrauchsverlagerung
in günstigere Stunden des Tages finanzielle Einsparungen erreichen
können. Zudem ist davon auszugehen, dass Spotprodukte zumindest über
einen längeren Zeitraum hinweg preislich etwas besser abschneiden
sollten als Fixpreisprodukte, weil in einem solchen Fall seitens der
Lieferanten keine Preisabsicherung notwendig ist. Um dies besser
beurteilen zu können, berechnet und vergleicht das Preisportal die
Kosten der verschiedenen Produkte. Dabei zeigt sich, dass ein
typisches Spotprodukt in den Jahren 2019 und 2020 sowie 2023 und 2024
eine günstigere Option darstellte als alle Hauptprodukte. [3] In den
außergewöhnlichen Krisenjahren kostete das Spotprodukt hingegen viel
mehr als die Hauptprodukte. Im Allgemeinen reagiert das Spotprodukt
direkt auf Preisveränderungen am Großhandelsmarkt (hohe Kosten vor
allem im Jahr 2022), während Fixpreisprodukte Preissteigerungen in
der Beschaffung verzögert weitergeben (hohe Kosten in den Jahren 2023
und 2024). „Über die letzten sechs Jahre hinweg zahlten Kund:innen
eines Spotproduktes insgesamt weniger als bei acht Hauptprodukten.
Bis zu 515 Euro ließen sich im Vergleich zum Hauptprodukt einsparen.
Lediglich einige Hauptprodukte insbesondere aus dem Westen des Landes
waren über die letzten sechs Jahre hinweg gerechnet günstiger als das
Spotprodukt.“, analysiert Urbantschitsch die Daten.
Die E-Control beobachtet die Entwicklungen der Energiemärkte auch
2025 weiterhin sehr genau, um Problemfelder aufzuzeigen und
Lösungsvorschläge zu machen. Initiativen wie die Zusammenarbeit mit
der Bundeswettbewerbsbehörde bei der Taskforce Energie sind dabei von
besonderer Bedeutung. „Marktbeobachtungen sind entscheidend, um
einerseits Transparenz zu schaffen und andererseits den Wettbewerb
weiter zu stärken.“, betont Urbantschitsch. Die Veröffentlichung des
Endberichts der Taskforce ist für Mitte des Jahres geplant.
Zwtl.: Versorgungssicherheit gewährleistet
Seit 1. Jänner fließt – wie allseits bekannt – kein russisches
Gas mehr über die Leitungen der Ukraine nach Europa und somit auch
nicht mehr nach Österreich. Aufgrund umfassender
Vorbereitungsarbeiten mit allen Beteiligten – Energieministerium,
Unternehmen der Gaswirtschaft und der Gas-Großverbraucher – war
Österreich trotzdem zu jeder Zeit ausreichend mit Gas versorgt. „Dass
diese Bemühungen auch bei den Konsument:innen angekommen sind,
bestätigt die Umfrage des MARKET Instituts. So hat das subjektive
Sicherheitsgefühl rund um die Energieversorgung weiter zugenommen.“,
zitiert Alfons Haber, Vorstand der E-Control. Betont dazu aber
gleichzeitig. „Natürlich muss der Fokus, jetzt am Ende der
Heizsaison, schon auf dem nächsten Winter liegen.“
Zwtl.: Nach der Heizsaison ist vor dem nächsten Winter
Im November 2024 wurden die Gaslieferungen der Gazprom Export an
die OMV Marketing und Trading eingestellt, seit 1. Jänner 2025 ist
der Transit von russischem Gas durch die Ukraine aufgrund von
fehlenden vertraglichen Transportregelungen beendet worden. Das
bedeutet – wie bereits bekannt ist -, dass die österreichische
Gasversorgung zukünftig vollständig über andere Importrouten erfolgen
werden wird. Da der Speicherfüllstand am Anfang der Heizsaison, also
zum 1. November 2024, mit 96 TWh bzw. 94 % hoch war, die
Großhandelspreise im Winter 2024/2025 deutlich angestiegen sind und
es somit starke Anreize zur Ausspeicherung gab, ist ein wesentlicher
Teil (ca. zwei Drittel) des Gasverbrauchs der letzten Monate durch
Speicherentnahmen gedeckt worden. Auch die sinkende Preiskurve hin
zum nächsten Winter verstärkte den wirtschaftlichen Anreiz zur
Ausspeicherung. Der restliche Teil stammt aus Importen aus
Deutschland und Italien. Zum jetzigen Zeitpunkt (die letzt
verfügbaren Daten sind vom 24. März 2025) liegt der Speicherfüllstand
in österreichischen Speichern bei etwas mehr als 44 TWh.
„Aus unserer Sicht braucht sich aber niemand vor dem nächsten
Winter zu fürchten. Durch die strategische Reserve von 20 TWh und die
gesetzlichen Verpflichtungen für Versorger und Stromerzeuger, wird
auch am Anfang der Heizsaison 2025 durch diese Maßnahmen zumindest 30
TWh gesichert eingespeichert sein. Zudem sind die Speicher in
Österreich, bezogen auf das Arbeitsgasvolumen, bereits jetzt zu ca.
92 Prozent (bezogen auf das Arbeitsgasvolumen) für das Speicherjahr
2025/2026 gebucht. Bei ausreichenden wirtschaftlichen Anreizen und
zur Sicherstellung der Erfüllung von Lieferverpflichtungen an
österreichische Versorger und Industriekund:innen ist damit auch von
der Nutzung der Speicherverträge auszugehen.“, gibt sich Haber
optimistisch. Für die Befüllung der Speicher in den Sommermonaten
werden höhere Importe aus Deutschland und Italien als in den
vergangenen Jahren notwendig sein. Die Importkapazitäten dafür sind -
auch aufgrund von Erweiterungen in den letzten Jahren - ausreichend
vorhanden. Mit dem Ausbau des WAG Teilloops bis 2027 wird zukünftig
der Import über Deutschland zudem noch stärker an Bedeutung gewinnen.
Zwtl.: PV-Ausbau hat sich fortgesetzt
Auch 2024 hat es beim PV-Zubau einen weiteren Aufwärtstrend
gegeben. So waren mit Ende 2024 insgesamt über 8.300 MW PV-Kapazität
am Netz, das sind mehr als 470.000 Anlagen. „Der Boom bei der PV ist
also weitergegangen. 2022 sind 1.000 MW, 2023 2.500 MW und 2024 2.200
MW PV-Erzeugung ans Netz gegangen.“, erläutert Haber die aktuell
vorliegenden Zahlen. Und weiter: „Das bedeutet, dass bereits rund 25
Prozent der in Österreich an das Netz angeschlossenen
Erzeugungsleistung von 33.600 MW PV-Anlagen sind.“ Die Steiermark und
Niederösterreich sind dabei jene Bundesländer, in denen es 2024 die
meisten Anträge gegeben hat, und zwar mit jeweils rund 28.000
Anträgen. Auch Batteriespeicher werden immer beliebter. So wurden im
Jahr 2024 von den Verteilnetzbetreibern über 47.000 Speicher
gemeldet, 2023 lag diese Zahl noch bei 23.375.
Zwtl.: Neues Gesetz heiß ersehnt
In den vergangenen Jahren hat sich der Strommarkt stark
verändert. Neue Technologien haben sich entwickelt, neue Marktakteure
sind aufgetreten und die Stromerzeugung wird immer dezentraler. Damit
gehen große Herausforderungen aber auch Chancen für den Energiemarkt
einher, die es notwendig machen, den Rechtsrahmen umzugestalten. Vor
diesem Hintergrund wurde an einem neuen
Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) gearbeitet, das als Basis für
das Gelingen der Energiesystemwende dienen sollte. „Bekanntlich ist
das ElWG bisher nicht in Kraft getreten. Umso mehr begrüßen wir die
Pläne der neuen Regierung, dieses und zwei weitere Gesetze bis zum
Sommer 2025 zu beschließen. Und wir hoffen sehr, dass dies gelingen
wird.“, betont Alfons Haber. Die inhaltlichen Schwerpunkte sollten
dabei Endkund:innenrechte, dezentrale Versorgungskonzepte,
Netzbetrieb, Entgelte und Versorgungssicherheit sein.
Zwtl.: Netzentgelte gerechter verteilen
Sollte das ElWG wie geplant umgesetzt werden, kann begonnen
werden, die Leistungsmessung bis zur Netzebene 7 umzusetzen. „Damit
kann gewährleistet werden, dass die Kostenbeteiligung bei den
Stromnetzen wieder auf eine größere Basis verteilt wird, wenn nicht
mehr nur die verbrauchte kWh im Haushaltsbereich für die Verrechnung
relevant ist.“, sieht Haber die E-Control schon in den Startlöchern.
Und er betont dazu auch: „Zusätzlich wird es notwendig sein,
generelle Befreiungen von Netzentgelten zu minimeren, denn in diesem
Bereich ist der Vorteil des einen der Nachteil des anderen. Damit
kann die Kostenverursachungsgerechtigkeit wieder mehr in den Fokus
rücken. Netzdienliches Verhalten soll mit günstigeren Entgelten
unterstützt werden. Dies gilt nicht nur für Endkund:innen, sondern
auch für Speicheranlagen und wohl auch für Einspeiser.“
Die im Regierungsprogramm angeführten Maßnahmen zur Senkung der
Netzkosten werden von der E-Control generell begrüßt. „Die Vorteile
aus kostengünstigen EIB-Finanzierungen werden derzeit nur zu 65%
kostenmindernd berücksichtigt. Hier wäre gegebenenfalls eine
Anpassung der gesetzlichen Grundlagen erforderlich, um 100% davon für
die Netzkostendämpfung erreichen zu können. Auch andere
Finanzierungsoptionen und Beteiligungen könnten überlegt werden.“,
stellt Haber in den Raum.
Zwtl.: Regulierungsrahmen für Wasserstoff schaffen
Die Schaffung eines Regulierungsrahmens im Wasserstoffbereich,
die schnelle Umsetzung der EU-RL Gas- und Wasserstoffbinnenmarkt und
die schnelle Benennung der zuständigen Regulierungsbehörde werden als
wesentliche Maßnahmen zum Hochlauf des Wasserstoffbereichs im
Regierungsprogramm festgehalten. „Dies ist sehr positiv.“, hält Haber
fest, und er betont dazu: „Zudem erfordert die effiziente
Transformation des Gasbereichs die optimale Nachnutzung der
bestehenden Gas-Infrastruktur und die Stilllegung, wenn sie
wirtschaftlich geboten ist.“ Auch diese Maßnahmen sind im
Regierungsprogramm erwähnt.
Eine integrierte Planung ist wesentlich für das zukünftige,
erneuerbare Energiesystem, in dem die Flexibilitäten in der
Infrastruktur eine stärkere Rolle spielen werden.
Wasserstoffinfrastruktur kann dabei einen wichtigen Beitrag leisten.
Maßnahmen im Regierungsprogramm, die dort ansetzen, werden aus Sicht
der E-Control daher dezidiert begrüßt.
Zwtl.: Versorgungssicherheit stärken
„Die Wichtigkeit der Diversifizierung der Bezugsquellen von Gas
ist aufgrund der Energiekrise in den letzten Jahren in das
Bewusstsein aller gerückt - und zwar für die physische
Versorgungssicherheit und die preislichen Auswirkungen. Nach wie vor
gibt es politische Unsicherheiten in für die EU wichtigen LNG-
Exportländern. „Auch die Erhöhung des Anteils an erneuerbaren,
national erzeugten Gasen kann die Gasversorgung in Österreich und in
der EU insgesamt etwas stabiler machen. Daher begrüßen wir, dass
diese Themen auch im Regierungsprogramm aufgegriffen werden und eine
Gas-Diversifizierungsstrategie entwickelt werden soll, die auch die
preisliche Komponente der Versorgungssicherheit umfasst.“, betont
Haber.
Zwtl.: Viele wichtige Themen sind im Energiekapitel enthalten
Für eine weiterhin sichere, wettbewerbsfähige und leistbare
Energiezukunft benötigt es entsprechende Rahmenbedingungen. Die
rasche Verabschiedung längst geplanter Gesetzesvorhaben sind hier ein
wichtiger Meilenstein. „Wir sehen es zudem sehr positiv, dass im
neuen Regierungsprogramm eine Beschleunigung der
Genehmigungsverfahren bei Energiewendeprojekten vorgesehen ist.
Wollen wir die Energiewende weiter vorantreiben, müssen Projekte
deutlich rascher genehmigt werden.“, so Haber.
Prinzipiell hat die neue Regierung die wichtigsten Bereiche bei
der Energie klar hervorgehoben, nämlich leistbare Energiepreise,
Wettbewerb, Infrastruktur, Energiegemeinschaften, gezielte
Unterstützungen, Transparenz, Energieeffizienz, Netzkosten,
Wasserstoff, Gasinfrastruktur, Planung, Energiewende sowie
Innovation. „Letztendlich hängt es nun von der konkreten Umsetzung
der einzelnen Bereiche ab. Die E-Control als Regulierungsbehörde für
den Strom- und Gasmarkt steht auf jeden Fall bereit, neue Aufgaben
und Verpflichtungen mit dem gewohnten Engagement wahrzunehmen.“, so
Alfons Haber abschließend.
[1] MARKET Institut, Österreichische Bevölkerung ab 18 Jahre,
Sample 1.000, Zeitraum März 2025
[2] Das Hauptprodukt bezeichnet jenes Produkt eines Lieferanten
mit den meisten Kund:innen.
[3] Durch Verknüpfung der Verbrauchsdaten eines üblichen H0-
Haushalts (3.500 kWh) mit den Spotpreisen inklusive eines günstigen
Gesamtaufschlags von 2 Cent pro kWh können die jährlichen Kosten für
einen exemplarischen Spottarif berechnet werden.

Geldgespräch mit Julia Skobeleva: Alpha Mann mal Alpha Frau - geht es nur um Geld und wie unterschiedlich sind die Sprachen?
Aktien auf dem Radar:Porr, VIG, FACC, Addiko Bank, Pierer Mobility, Rosenbauer, Österreichische Post, Lenzing, Bawag, Andritz, AT&S, Mayr-Melnhof, Erste Group, Palfinger, RBI, UBM, Wienerberger, Warimpex, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Strabag, Austriacard Holdings AG, Agrana, Amag, Flughafen Wien, Kapsch TrafficCom, OMV, Telekom Austria, Uniqa, ATX.
Random Partner
UBM
Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.
>> Besuchen Sie 60 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Mehr aktuelle OTS-Meldungen HIER
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
28.03.
-
13:34
-
13:00
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
09:06
-
20:26
-
17:20
-
17:10
-
17:00
-
16:50
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
16:10
-
16:08
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:39
-
15:30
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:10
-
12:31
-
11:05
-
09:55
-
09:07
-
08:17
-
06:15
-
06:15
-
06:15
-
06:15
-
03:06