Wer ist gröÃer: Konzerne oder Nationalstaaten? Steigt die Macht der GroÃkonzerne? (Michael Hörl)
Wer ist gröÃer: Konzerne oder Nationalstaaten? Steigt die Macht der GroÃkonzerne? (Michael Hörl)
22.10.2012, 11999 Zeichen
Michael Hörl ist Wirtschaftspublizist aus Salzburg und hat am 2.7.2012 sein neues Buch, âDie Gemeinwohl-Falleâ veröffentlicht. Es sei als fundierte Antwort auf die Aussagen von Christian Felber, Jean Ziegler oder der Arbeiterkammer zu sehen.
U.a. Bericht hat er heute an Journalisten verschickt. Gerne bringe ich den Beitrag.
"Wissenschaftlich nachgemessen:
Steigt die Macht der GroÃkonzerne?
Karl Marx war zutiefst davon überzeugt, dass der Kapitalismus nur eine Handvoll industrieller Monopol-Konglomerate überlassen würde, die einer verarmten Weltbevölkerung das letzte Hemd abpressen würden. Globalisierungskritische Bewegungen wie Attac haben Karl Marxâ Vorwürfe heute zum zentralen Bestandteil ihres neuen Denkens gemacht. Misst man wissenschaftlich nach, scheint die Urangst allerdings unbegründet zu sein.
Seit 150 Jahren wirft man den Konzernen die zunehmende Ballung wirtschaftlicher und politischer Macht vor. Um das Bedrohungsszenario zu illustrieren, vergleicht man gerne deren Umsätze mit den Bruttoinlandsprodukten von Nationalstaaten. So würden in einer gemischten Liste von Konzernen und Ländern 51 Konzerne und nur 49 Länder liegen.
Wer ist gröÃer: Konzerne oder Nationalstaaten?
Doch lässt diese Betrachtungsweise auf den Bildungshorizont des Betrachters schlieÃen. Man kann das Volkseinkommen (BIP) eines Staates wirtschaftswissenschaftlich nicht mit dem Umsatz einer Firma vergleichen. Das BIP ist ja die Summe der Wertschöpfung aller Betriebe bzw. aller Produktionsstufe, also immer die Umsätze minus Wareneinkäufe. Wenn ein Ãlkonzern Produkte um 50 Milliarden Dollar verkauft, das Rohöl aber um 40 Milliarden eingekauft hat, beträgt seine Wertschöpfung nur 10 Milliarden. Und nur diese 10 Milliarden gehen in die Berechnung des BIPs ein. Den Bezug des Ãls ist dabei für viele Jahrzehnte vertraglich fix an ein bestimmtes Förderland gebunden, der wirtschaftliche Spielraum gering.
Konzern |
Umsatz in Mrd. Dollar |
Wertschöpfung in % |
Wertschöpfung in $ |
| General Motors | 184.632 |
22,80% |
42.096 |
| Royal Dutch/Shell | 149.146 |
24,30% |
36.242 |
| British Petroleum | 148.062 |
22,60% |
33.462 |
Paul De Grauwe von der belgischen Universität hat sich die Mühe gemacht und auf Basis von Jahresabschlüssen die Vorleistungen von Konzernen herausgerechnet. Das Resultat ist erstaunlich. Nur ein knappes Viertel wird an Wertschöpfung im Land und vom Konzern erzeugt. Der Rest sind Zulieferleistungen. Im Jahr 2000 wäre General Motors mit 184 Milliarden Dollar Umsatz noch weltweit am 23. Platz gewesen, gleich hinter Ãsterreich. Zieht man von den 184 Milliarden aber die zugekauften Vorprodukte ab, so ist er mit einer Wertschöpfung von 42 Milliarden Dollar nur mehr auf Platz 46 â vor Nigeria. Royal Dutch/Shell sinkt bei wissenschaftlicher Betrachtung von Platz 28 (vor Saudi-Arabien) auf Platz 62 ab, BP auf Platz 63. Das ist nur mehr knapp vor Rumänien.[1] Und das braucht niemandem mehr Angst einzujagen.
Wachsen Konzerne ins Unermessliche?
âDie 500 gröÃten Konzerne kontrollierten 1994 ein Viertel des Welt-BIPs, 2005 war es schon mehr als ein Drittelâ, so Christian Felber (Attac) Angst einflöÃend[2]. Was der Globalisierungskritiker nicht sagt (oder weiÃ?): Es sind niemals dieselben Konzerne (oder aus denselben Ländern) an der Spitze.
In Europa gilt es als unbestritten, dass Konzerne unkontrolliert gröÃer würden und aufgrund ihrer schieren Macht die Politik (der Europäischen Union), ja wenn nicht gleich die ganze Welt beherrschten. Betrachtet man sie aber über die Jahrzehnte, so sind manche Konzerne zwar gewachsen, manche allerdings verschwunden. An den drei US-Autokonzernen sieht man es gut: General Motors musste sich (nach dem Konkurs) verkleinern, Chrysler wurde von Fiat übernommen. Und Ford ist schlicht und einfach langsamer gewachsen als die Weltwirtschaft. In nur 40 Jahren sind alle drei US-Konzerne aus den Top 15 rausgeflogen.
Die 15 weltgröÃten Konzerne waren von 1970 bis 2010 ⦠|
|||
1970 |
1990 |
2005 |
2010 |
GM |
GM |
Wal-Mart |
Wal-Mart |
Exxon Mobil |
Ford |
BP |
Shell |
Ford |
Exxon Mobil |
Exxon Mobil |
Exxon Mobil |
General Electr. |
IBM |
Shell |
BP |
IBM |
General Electr. |
GM |
Toyota |
Chrysler |
Mobil |
DaimlerChrysler |
Japan Post |
Mobil |
Altria Group |
Toyota |
Sinopec |
Texaco |
Chrysler |
Ford |
State Grid |
ITT |
DuPont |
General Electr. |
|
Gulf Oil |
ChevronTexaco |
Total |
China Petroleum |
AT&T |
Amoco |
ChevronTexaco |
Chevron |
US Steel |
Shell |
ConocoPhillips |
ING Group |
ChevronTexaco |
Procter&Gamble |
Axa |
General Electr. |
LTV |
Boeing |
Allianz |
Total |
DuPont |
Occidental |
Volkswagen |
Bank of America |
Beobachtet man den Zeitraum von nur 40 Jahren, dann ist eines klar: Die Angst vor der Welt-Herrschaft des Kapitals ist unbegründet. Von den 15 gröÃten Firmen im Jahr 1970 kamen fast alle aus den USA. Nur 20 Jahre später, 1990, waren von den 15 besten aus dem Jahre 1970 schon nur mehr 9 übergeblieben. Weitere 15 Jahre später, 2005, gar nur mehr 5. Und im Jahr 2010 waren von fünfzehn Mega-Konzernen aus dem Jahr 1970 noch ganze drei im Jahr 2010 übergeblieben. Wer die âFortune 500â-Listen der letzten Jahre unter die Lupe genommen hat, der ahnt, woher die Konzerne der nächsten 20 Jahre kommen werden: Aus China. Und auch Chinas Konzerne werden nicht ewig tonangebend sein. In 40 Jahren werden sie vielleicht von indischen eingeholt worden sein.
Viele multinationale Konzerne sind also nicht unkontrolliert gröÃer â sondern im Gegenteil â kleiner geworden. Oder sie verschwanden ganz vom Kurszettel. Der US-Rüstungs- und Stahlkonzern LTV ist zum Beispiel so ein Fall. 1970 hätte er Marxisten noch das Fürchten gelehrt, vereinte er doch alle Produktionsstufen der âOld Economyâ â von der Stahlgewinnung über die Elektronik bis zum Bau von Jagdbombern (A7 Corsair). Doch das Warten hat sich ausgezahlt. Im Jahr 2000 war die Firma pleite.
Wenn die GroÃen vor die Hunde geh`nâ¦
ITT wurde 1920 auf Puerto Rico gegründet, als zwei Zuckermakler, die Brüder Sosthenes und Hernand Behn, im Rahmen ihrer Tätigkeit statt unrentabler AuÃenstände die Puerto Rico Telephone Company erhielten. Der Konzern gehörte bald zu den gröÃten Telefongesellschaften der Erde. Ende der 1970er Jahre lief es in manchen Bereichen nicht mehr so gut. Bis 1995 wurden Unternehmensteile entweder abgespalten oder verkauft. Heute gibt es ITT so gar nicht mehr.
Der AT&T-Konzern betrieb das US-amerikanische Fernsprechnetz. Unglücklicherweise nur bis 1984. In diesem Jahr wurde der Konzern vom US-Kartellamt in 9 kleine Firmen zerschlagen.
US Steel beschäftigte im Zweiten Weltkrieg 340.000 Menschen. 1970 war es noch das zwölftgröÃte Unternehmen der Welt. Mit dem Erstarken der japanischen Konkurrenz in den 1980er Jahren begann sein Niedergang. Heute hat sich der Konzern aber auf vergleichsweise niedrigem Niveau stabilisiert.
Gulf Oil war einst der siebtgröÃte Ãlkonzern der USA, mit den 1960ern begann der schleichende Niedergang. 1984 wurde er mit Chevron fusioniert.
General Motors, über Jahrzehnte hinweg weltgröÃter Konzern und Flaggschiff der US-Industrie, musste sich 2008 unter Chapter XI (US-Gläubigerschutz für insolvenzgefährdete Betriebe) verstecken, wurde dann vom Staat gerettet und backt nach seinem Neustart heute bedeutend kleinere Brötchen.
Die Liste lieÃe sich beliebig fortsetzen. 1867 erschien Karl Marxens erster Band des âKapitalsâ. Wer den Kurszettel der Londoner Börse aus diesem Jahre studiert, wird wahrscheinlich keine einzige Firma davon mehr heute kennen. Geschweige denn, dass sich daraus weltumspannende Monopol-Konglomerate gebildet hätten. Damit können die Konzerne von damals heute also weder Wirtschaft, Politik oder Menschen kontrollieren. Und das ist auch gut so.
Wer nun moniert, dass vor allem besonders börsennotierte Konzerne kleinere vom Markt verdrängten, möge die Marktkapitalisierung von anno dazumal mit der von heute vergleichen. Die âMarktkapitalisierungâ errechnet sich aus der Anzahl ausgegebener Aktien multipliziert mit deren aktuellem Börsenwert. Somit spiegelt die Kapitalisierung den momentanen Börsenwert einer Firma wider.
Börsenkapitalisierung: Konzerne haben`s schwer
Heutiger Rang der TOP 15-Konzerne des Jahres 1980 bei Börsenkapitalisierung[3]   (nach Börsenkapitalisierung) (Bloomberg/DWS/Goldman Sachs 2010) |
||
1982 |
2010 |
|
| IBM | 1. |
16. |
| Exxon Mobil | 2. |
1. |
| Schlumberger | 3. |
45. |
| Chevron | 4. |
21. |
| BP | 5. |
36. |
| General Electric | 6. |
19. |
| General Motors | 7. |
129. |
| Royal Dutch Shell | 8. |
12. |
| Eastman Kodak | 9. |
>500. |
| Halliburton | 10. |
229. |
| Conoco Phillips | 11. |
58. |
| Union Pacific | 12. |
165. |
| 3M | 13. |
111. |
| Toyota | 14. |
28. |
| Merck & Co. | 15. |
44. |
Konzernen mit einer hohen Börsenkapitalisierung (also vielen Aktien bei hohen Aktienkursen) traut die Börse (also der Markt, also die Spezialisten in den Investmentfonds) besonders starkes Wachstum zu. Wenn wir aber die Stars aus dem Jahre 1980 betrachten und sie mit denen aus dem Jahre 2010 vergleichen, zeigt sich schnell: Einen garantierten Platz auf dem Siegerpodest gibt es im Leben nun einmal nicht, auch nicht für die GröÃten dieser Welt.
Die dauernde Veränderung an der Spitze der gröÃten Konzerne verdeutlicht sowohl die Entwicklungsstufen als auch die Moden der jeweiligen Wirtschaft. Die 1980er waren von Ãl- und Maschinenkonzernen (etwa Autos) dominiert, etwa die Hälfte von ihnen förderte den Schmierstoff der âOld Economyâ. In den 1980er Jahren lösten japanische Konzerne US-amerikanische ab â im Jahre 1990 stammten bereits acht Unternehmen aus dem Land der aufgehenden Sonne. Plötzlich waren 1990 auch fünf Bankkonzerne unter den Top 15, und alle fünf kamen aus Japan.
Die Angst der Amerikaner, dass âdie Japanerâ in den 90ern Amerika aufkaufen würden, war groÃ. Und unberechtigt. All die schönen japanischen Autos, die vor laufender Kamera demoliert wurden (teils mit Vorschlaghämmern âMade in Japanâ), waren dem Kleingeist umsonst geopfert worden. Oder erinnern Sie sich noch an die âIndustrial Bank of Japanâ? Oder die âFuji Bankâ, die âSakura Bankâ, die âSumitomo Mitsui Financialâ und die âDai-Ichi Kangyo Bankâ? Die fünf ehemaligen Top-Konzerne notieren heute unter âferner liefenâ.
Und weitere zehn Jahre später? Im Jahr 2000 sind alle japanischen Banken von der âSiegerlisteâ verschwunden. Dafür ist eine US-amerikanische unter die âTop 15â gestoÃen, die Citigroup. Und bereits vier chinesische Konzerne haben es geschafft. Und einige US-Investmentfonds. Doch auch vor den âmächtigenâ Investmentfonds muss keiner Angst haben. Sie besitzen ja nur die Anteile anderer Firmen â und gehören (über die veranlagten US-Lebensversicherungen) den Menschen selber. Zumindest denen aus Amerika.
Insgesamt kommen nur mehr 40% der Top-Konzerne aus Amerika, und der Trend geht unaufhörlich weiter Richtung Schwellenländer. Nach neomarxistischer Lehre sollten aber gerade die Schwellenländer durch die Verschwörung des (nördlichen) Kapitals am Boden niedergehalten werden. Doch die aufstrebenden Nationen Süd- und Ostasiens oder Lateinamerikas kümmern sich nicht um den ihnen prognostizierten Niedergang â sie wachsen mit teils 10 Prozent im Jahr der Nordhalbkugel auf und davon. Ob das den Pessimisten (des Nordens) passt oder nicht.
Konzerne: Weltverschwörung abgesagt
Wer heute â 145 Jahre nach Veröffentlichung von Karl Marx´ âKapitalâ â noch immer an die Verschwörung des Kapitals und seinen Drang zur Weltherrschaft glaubt (sowie 50% der Deutschen das tun) â dem ist entweder nicht mehr zu helfen â oder er ist ein Produkt des europäischen Bildungssystems. Wer Wirtschaft nicht versteht â und es nie verstanden hat â der reimt sich die Welt mit Komplotten zusammen.
Wenn wir es nicht endlich schaffen, Europas Bevölkerung betriebswirtschaftlich auszubilden, dass brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir es eines Tages vielleicht heimlich im Untergrund tun müssen.
[1] âHow big are the multinational Companies?â, Paul De Grauwe, University of Leuven and Belgian Senate, 2002
Was noch interessant sein dürfte:



Wiener Börse Party #883: ATX rauf, die 5 Mrd.-Sache bei der Erste Group und der positive Erste-Blick auf die Konkurrenten von der RBI
Aktien auf dem Radar:Flughafen Wien, DO&CO, Porr, Pierer Mobility, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, CA Immo, Polytec Group, Zumtobel, Bawag, Erste Group, FACC, Kapsch TrafficCom, OMV, Palfinger, RBI, Rosenbauer, SBO, Semperit, Wienerberger, Amag, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, VIG, MTU Aero Engines, Vonovia SE, E.ON , Symrise, Fresenius Medical Care, Airbus Group.
Random Partner
DenizBank AG
Die DenizBank AG wurde 1996 gegründet und ist eine österreichische Universalbank. Sie unterliegt dem österreichischen Bankwesengesetz und ist Mitglied bei der gesetzlichen einheitlichen Sicherungseinrichtung der Einlagensicherung AUSTRIA GmbH. Die DenizBank AG ist Teil der türkischen DenizBank Financial Services Group, die sich seit 2019 im Besitz der Emirates NBD Gruppe befindet.
>> Besuchen Sie 60 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- PIR-News: News zu EVN, Research zu UBM, RBI, Freq...
- (Christian Drastil)
- Wiener Börse Party #883: ATX rauf, die 5 Mrd.-Sac...
- Wiener Börse zu Mittag deutlich fester: AT&S, Pal...
- D&D Research Rendezvous #13: Gunter Deuber mit Rü...
- EVN geht nächsten Schritt bei Klimaschutz-Anstren...
Featured Partner Video

Wiener Börse Party #873: ATX schwächelt am Ende eines starken Q1, Final Countdown by my Schulband heute mehrfache Untermalung
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com

O Tannenbaum
2024
pupupublishing
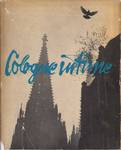
Cologne intime
1957
Greven

Islands of the Blest
2014
Twin Palms Publishers
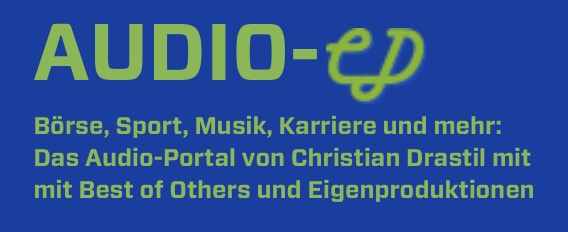



 Yorgos Lanthimos
Yorgos Lanthimos Daniel Chatard
Daniel Chatard Maja Daniels
Maja Daniels Bryan Schutmaat
Bryan Schutmaat Robert Longo
Robert Longo